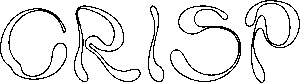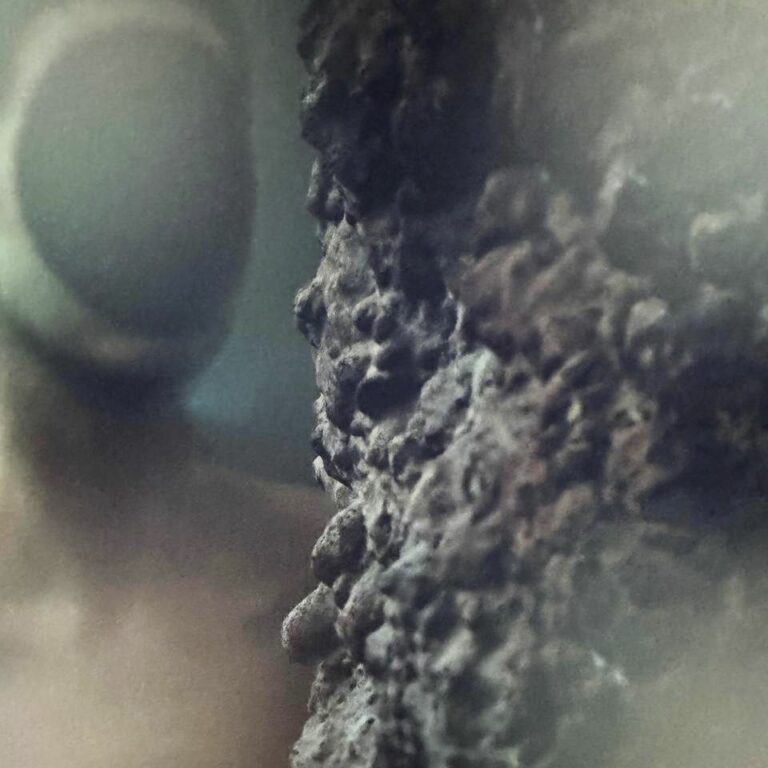Bye-bye Berlin, Berlin bye-bye
Alles dahin, endlich sind wir frei
– Tocotronic, 2025
In ihrem Song „Bye Bye Berlin“ verabschieden Tocotronic eine Ära: „Berlin, dein Berghain brennt!“, heißt es darin, 20 goldene Jahre gehen nun zu Ende. Wohin es Tocotronic jetzt zieht, geben sie noch nicht bekannt. Ihr künstlerischer Abgesang reiht sich ein in eine spezifische Wahrnehmung der Stadt, die international bereits zu einem eigenen Namen gefunden hat: In der Kunstszene taucht Berlin seit einiger Zeit vermehrt in Verbindung mit dem Label „post-cool“ auf. Das Kunstmagazin Spike setzte „The Post-Cool“ im vergangenen Winter sogar auf ihren Titel und widmete Berlin darin ein ganzes Feature – kein Zufall, nachdem das Land Berlin im September 2024 breite Kürzungen im Kulturetat ankündigte. Die Schriftstellerin Helene Hegemann, selbst Bewohnerin dieser Stadt, beschreibt die derzeitige Post-Coolness Berlins auch damit, dass die Stadt einem „Ex-Heroin-Chic-Model“ gleiche.
Dass Berlin offenbar an Coolness eingebüßt hat, zeigt auch ein pragmatischer Blick auf das Tourismusaufkommen: In den letzten beiden Jahren besuchten mehr als eine Million Menschen weniger die Hauptstadt als in den Jahren zuvor. Die geplanten Einsparungen in der Kunst-, Kultur- und Clubszene werden hierauf noch zusätzlichen Einfluss haben, der atmosphärisch spürbar sein wird. Der Grabstein, den das Kollektiv Steinzeit.Alter vor den ehemaligen Watergate-Club gesetzt hat, demonstriert ganz gut, wohin die Reise gehen könnte. Fatma Aydemir schreibt im Guardian, die Stadt werde nun den „rich kid artists“ überlassen, „arm, aber sexy“ sei nun vorbei. „Ein letzter Kuss im Business-Park“, heißt es in dem Lied von Tocotronic, dann ziehe man besser aus der Stadt heraus.
Diese Behauptung, dass es in Berlin mit der Coolness vorüber sei, ist allerdings gar kein neues Phänomen: Schon 2015 gab es Stimmen, die vorbrachten, Berlin sei nicht mehr „cool“ und verliere durch den Ausverkauf seine Essenz. Es stellt sich daher die Frage, wie „Coolness“ als Hype und Phänomen funktioniert – bis sie jeweils zyklisch in den Mainstream übergeht – und was eine „Post-Cool“-Ära auch mit der Kunstszene zu tun hat. Denn der kritisierte Ausverkauf findet auch durch die Szene selbst statt, zugunsten von Kommerz und der Anpassung an ökonomische Realitäten.

Ein letzter Kuss im Co-Working-Space.
Coolness als Ästhetik der Stadt
Als szenetypisches Phänomen ist Coolness untrennbar mit Berlin verwoben und der Begriff keinesfalls beliebig gewählt. Er verbindet sich mit dem Namen der Stadt, weil es die vielen Subkulturen und Szenen sind, die Berlin ausmachen. Als kulturelle und ästhetische Strategie wird Coolness seit jeher mit Berlin assoziiert, „Szenen-Coolness“ weiß man hier sehr sicher zu bespielen. Wird das Ende der Coolness verkündet, weist das zugleich auf eine deutliche Veränderung des künstlerischen und kulturellen Geschehens hin.
In gewisser Weise wird „Coolsein“ auch von den Bewohner*innen erwartet. Sympathiepunkte kriegt die Stadt dafür nicht (wer in Berlin lebt, spürt immer wieder mal den Konflikt zwischen Authentizität auf der einen Seite und Anpassung an den geltenden Coolness-Kodex auf der anderen), trotzdem ist Coolness das Distinktionsmerkmal der Stadt schlechthin. Die cool kids der Stadt wissen ganz intuitiv, wie sie performen müssen; cool zu sein bedeutet hier, exzessiv und unnahbar zu sein, die richtigen Orte und Leute zu kennen und streng zwischen cool/uncool zu unterscheiden. Die „harte Tür“ Policy Berlins drückt ganz gut aus, was Coolness in der Praxis tut: selektieren.
In der Coolness liegt zwangsläufig eine Selbstüberschätzung, denn man vergisst, dass der Underground auch woanders stattfindet. Als kulturelle, bewusst oder häufig auch unbewusst ausgeübte Praxis sind Coolness-Codes immer ortsspezifisch: die Adidas-Trainingshose ist kein universelles Symbol. Angesichts der mit Coolness verbundenen Zwänge wäre es also eigentlich wünschenswert, wenn die Stadt nun in die Post-Cool-Ära eintritt.
Als Begriff bleibt Coolness unscharf und stark abhängig von subjektiven Eindrücken und Erfahrungen. Den Versuch, sie wissenschaftlich zu erfassen, wagte die Amerikanistin Ulla Haselstein in einem Vortrag an der FU Berlin: Mit dem Coolsein ziele man darauf ab, von seinesgleichen erkannt zu werden. Man muss in der Coolness „in der Lage sein, sich zu verbergen“. Das, was die Coolness einfordere, das Cool-Distanzierte sei aber immer etwas Gemachtes: Coolness ist Konvention, kein Gesetz. Einen Vortrag zur Post-Coolness gibt es von ihr noch nicht.
Hier könnte man an Anne Imhof denken, die Künstlerin, die Coolness gemacht hat (auch wenn ihre „Street-Cred“ auf ihrem ehemaligen Job im westdeutschen Club Robert Johnson gründet). Vielleicht war sie eher die künstlerische Katalysatorin eines schon länger bestehenden Coolness-Phänomens. Ihre von Szeneästhetik geprägten Arbeiten aber hatten einen großen Einfluss auf den Modus des Distanzierten innerhalb der Szene selbst. Der große Hype um mit Imhof mehr oder weniger assoziierte Orte wie der Schinkel-Pavillon oder die Galerie CFA (Contemporary Fine Arts) und deren internationale Strahlkraft bezeugen die Coolness-Performanz Imhofs und ihrer Lebensgefährtin und künstlerischen Partnerin Eliza Douglas.

Berlin Starter-Pack. Foto: @berlinclubmemes
Post-Cool, oder: „How To Get Into Berghain“
Jetzt bekommt die Coolness schon dadurch Risse, dass die ganzen Coolness-Performanzen inzwischen breit geteilt und offengelegt werden. Ein Video, das erklärt, wie man es an dem gefürchteten Türsteher Sven Marquart vorbei ins Berghain schafft, hat auf YouTube ganze 4.4 Millionen Aufrufe. Der Underground ist längst viral gegangen – alle wissen, worum es geht. Auch die Wissenschaft ist dieser Frage auf den Fersen und versucht, das „Einlass-Prinzip“ der Berliner Clubs aufzudröseln. Orte, die gerade aufgrund ihrer Unerreichbarkeit ehemals als cool markiert waren, werden mittlerweile offen geteilt. Am Beispiel Berghain hatte die Covid-19-Pandemie doppelten Einfluss: Mit Studio Berlin eröffnete im Berghain eine Ausstellung – ein Wink des damaligen Kultursenators Klaus Lederer, um die Kunstszene in der pandemischen Krise wieder anzukurbeln – weshalb es per Online-Ticket plötzlich jedem möglich war, in den Ort der Coolness zu marschieren. Die Setzung Lederers sorgte damals für Kritik, da weltbekannte Künstler*innen wie Olafur Eliasson oder John Bock im kultigen Club ausstellten und alle vorher intimen Räume plötzlich öffentlich zugänglich waren. Der plötzlich demokratische Zugang zum Berghain warf Fragen auf: War dieser breitere Zugang wünschenswert – oder markierte das den endgültigen Ausverkauf der Szene?
An Anne Imhof und ihrem Netzwerk lässt sich ebenfalls gut beobachten, wie Coolness zu einem ambivalenten Modus wird: Das Arbeiten mit coolen Ästhetiken (Berlin als Hauptstadt der Techno- und Clubkultur, subkulturelle Referenzen, Selbstinszenierung, Genderfluidität) wird plötzlich zu einem Programm, das global anschlussfähig ist, das kommerziell funktioniert – auch außerhalb Berlins. Dieser Modus von Coolness als Ästhetik ist dann selbst Teil des Ausverkaufs, den er ursprünglich zu hinterfragen oder zu unterlaufen vorgab. Die Ästhetisierung des Subversiven als ultimative Post-Coolness sozusagen.
Robert Schulte, der Direktor der Julia Stoschek Foundation, macht das Ende der Berliner Coolness im Spike-Magazin nüchtern an den veränderten Schließzeiten der Bars in der Stadt fest. Die Schmetterling Bar in Kreuzberg etwa müsse mittlerweile bereits um 02 Uhr morgens schließen, weil sich sonst die (uncoolen) Nachbarn beschweren. Schulte sieht hierin „the clearest manifestation of a new mood in the city, embodying a new Berlin – a post-cool Berlin“. Dieser neue Modus muss aber gar nicht zwangsläufig etwas Negatives bedeuten. Vielmehr beschreibt der Ausdruck für Schulte eine Phase oder einen Übergang, in dem Elemente und Ästhetiken, die ehemals als cool galten, nicht mehr dieselbe Bedeutung haben wie zuvor. Schultes Definition spricht sich also für Post-Coolness als eine Verschiebung ehemaliger Hypes aus.
Bei Imhofs stilisierter Coolness-Strategie wird jedoch deutlich, wie fragil das Konzept von Coolness auch ist: Sobald es Teil eines marktförmigen Ästhetiksystems wird, steht es vor der Notwendigkeit, sich selbst zu dekonstruieren, als eine Art Post-Coolness, die jede Coolness verloren hat.
Schon wieder ein neuer Postismus?
Das Label post-cool steht hier kritisch für einen Kunstbegriff, der seine ursprünglichen Ideale nicht mehr erfüllen kann. Aber auch für eine gesellschaftliche und politische Entwicklung, die Kunst und Kultur nicht mehr genügend Raum einräumt. Die Betitelung „Post-Cool“ versucht den Verlust der Essenz einer Stadt einzufangen, den auch Tocotronic und andere Künstler*innen bereits spüren. Ein Abgesang, eine Feststellung, ein Warnruf. Tocotronic geben jetzt schon (oder endlich?) auf.
In dem kürzlich erschienenen Buch Post-. Nachruf an eine Vorsilbe schlägt der Philosoph Dieter Thomä vor, es mit der Post-Vorsilbe komplett zu lassen: Post– ist für ihn immer nur ein Rücklauf auf etwas, das sowieso schon existiert und leitet nur scheinbar in einen neuen Zustand über. Wirkliche Veränderung geschehe erst, wenn man sich radikal der Gegenwart stelle. Etwas von dieser Forderung kommt trotzdem im Begriff der Post-Coolness zum Ausdruck: Der Wunsch, sich eben jenseits aller Coolness-Attitüden auf die Seite dessen zu stellen, worauf es wirklich ankommt; sich weniger von der Coolness blenden zu lassen und mehr auf das Tatsächliche zu schauen: Wie kann man sich der Welt stellen, frei von Ironie und Defätismus, und sich auf produktive Weise mit ihr auseinandersetzen?

Zwischen September 2020 und August 2021 wurde das Berghain zur Kunsthalle umfunktioniert.
© Studio Berlin / Boros Foundation, Berghain, Berlin 2020. Artwork: © Rirkrit Tiravanija. Photo: © Noshe
Bye bye Coolness, bye bye Berlin?
Der Begriff der Post-Coolness steht daher nicht für eine ästhetische Verschiebung, sondern für ein Symptom kultureller und gesellschaftlicher Umbrüche, das insbesondere am Beispiel Berlins spürbar ist. Er kündet von dem Versuch, eine Welt um uns herum zu verstehen, die sich gerade in tiefgreifender Veränderung befindet: Auf städtischer Ebene geht es um Verdrängung, steigende Mieten, den Verlust der kulturellen Räume, die Coolness erst möglich machten; auf einer tieferen, kulturellen Ebene verliert Coolness als Begriff an Schärfe, weil sie selbst zunehmend zur Inszenierung geworden ist. Post-Coolness erscheint als das Nachglühen eines Versprechens, das in Berlin sehr lange gültig war: Das Versprechen vom rebellischen Anderssein, vom kreativen Überfluss mit wenigen Mitteln, das sich nun in der Kommerzialisierung umkehrt. Institutionen und Orte ehemaligen Außenseitertums – Orte der Coolness – sind heute Teil des kulturellen Establishments, klar eingebunden in einen marktkompatiblen Kontext. Coolness muss man sich mittlerweile leisten können und ist zum Luxus geworden.
Daher löst „post-cool“ endgültig Klaus Wowereits „arm, aber sexy“ ab. „Arm“ ist Berlin schon lange nicht mehr und eine Kulturszene, die massiv auf staatliche Unterstützung angewiesen ist und nun radikale Kürzungen vornehmen muss, ist wenig „sexy“. Anstelle der Kunst als Kern der Stadt tritt das Geld, begleitet von den rich kids artists, die sich die Räume und Mieten noch leisten können. Und den wenigen etablierten Künstler*innen, die schon Zugang zu finanziellen und institutionellen Ressourcen haben. Statt widerständiger Kunst werden zunehmend Kapital und Post-Coolness das Stadtbild prägen.
Berlin war und ist aber noch immer eine politische Stadt. Deshalb steckt in dem Label Post-Coolness auch der Ruf: Wo bleibt die raue, politische Form der Coolness, die ihr mal hochgehalten habt?
Helene Hegemann gibt schließlich zu: „Man hat hier schon immer noch ziemlich viel Glück. Mir fällt kein vergleichbarer Ort ein.“ Damit das mit dem Glück aber nicht noch willkürlicher wird – und man Berlin nicht wie Tocotronic im Refrain verlässt – muss für die Kunst in der Stadt gekämpft werden.