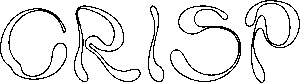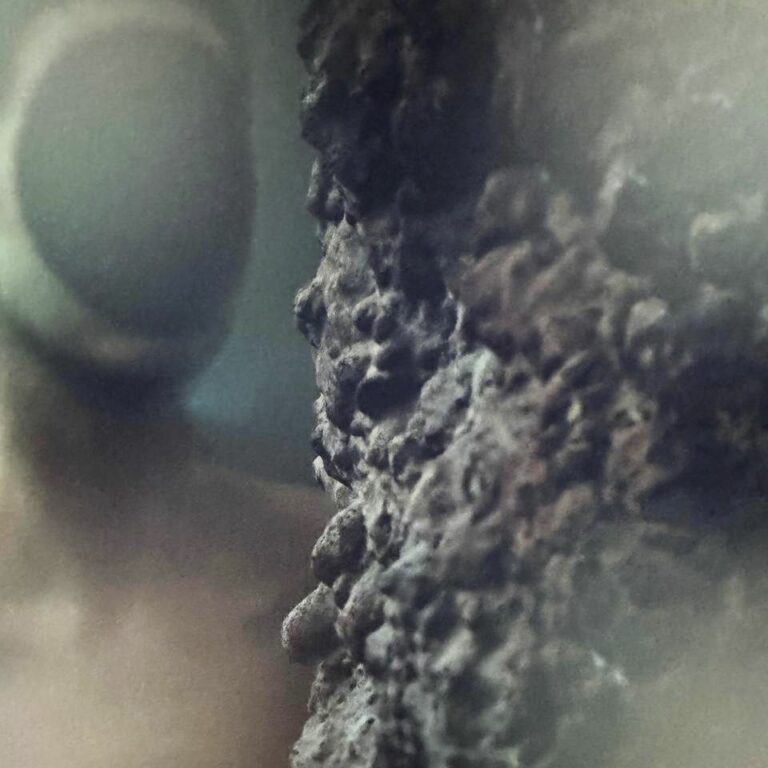Breaking News: Die Venus Medici im Bundesamt für zentrale Dienste und offene Vermögensfragen in Berlin wurde entfernt! Und die wilden Kerle mittleren Alters von Welt, Bild & Co. zerreißen sich schon die Mäuler darüber. Keine Sorge, ganz weg ist sie nicht: Nun ist unser Girl Venus im Grassi Museum in Leipzig zu sehen. Und wenn ihr genauso wie ich bis vor kurzem noch nicht wusstet, dass in den Hallen der Berliner Behörden überhaupt eine Venus-Skulptur gestanden hat, dann ist sie immerhin ein klein wenig bekannter geworden. Wie sagt man so schön: Es gibt keine schlechte Publicity.
Der Grund für die Entfernung der Bronzeskulptur war die Sorge einer Gleichstellungsbeauftragten: Diese argumentierte, dass die Arbeit als sexistisch wahrgenommen werden und es deswegen zu Beschwerden kommen könnte. Eine Vorsichtsmaßnahme also. Gerne kann man an dieser Stelle über die Implikationen von vorauseilendem Gehorsam diskutieren. Dass dieser Vorstoß durchaus irritieren kann, mag ich nicht bezweifeln. Grassi Museumsdirektor Olaf Thormann freut sich und vermutet dennoch Cancel Culture. So teilte er der Bildzeitung seine kunsthistorische Perspektive auf die Kontroverse mit:
„Den weiblichen Akt gibt es – genauso wie den männlichen – seit Anbeginn in der Kunstgeschichte. Daraus Sexismus zu konstruieren, verfehlt die gesamte Kunstgeschichte und ich möchte sagen, sogar den Blick auf etwas zutiefst Menschliches.“¹
Solche Äußerungen setzen einen ganz speziellen Geruch frei: Jenen penetranten, unverwechselbaren Odor von Bullshit. Es ist doch faszinierend, wie den alteingesessenen Kunsthistoriker-Bros unbegreiflich bleibt, dass kunsthistorische Wertschätzung und sexistisch-ideologische Ikonografien sich nicht gegenseitig ausschließen. Man hält an dem Glauben fest, dass die Kunstgeschichte durch und durch nur erstrebenswerte Ideale widerspiegle und mit Wahrheit, Schönheit und Güte das Gegenteil der vom Sündenfall getroffenen Welt sei. Ich will ja keine Spielverderberin sein, aber: Dem ist nicht so.
Ein kunsthistorischer Striptease
Olaf hat in einer Sache recht: Den weiblichen Akt gibt es wirklich seit Anbeginn der Kunstgeschichte. Die Venus von Willendorf gilt als eines der ältesten Beispiele der Menschheitsgeschichte: Fast stolze 30 Tausend Jahre ist sie alt. Als Abbild einer Fruchtbarkeitsgöttin feiert diese Figur den weiblichen Körper auf eine Art, wie ihn die westliche Kunstgeschichte jahrhundertelang sanktionierte: voluminös, mit Körperfett und explizit mit Vulva. Mit der Christianisierung hatte Nacktheit schließlich nichts mehr auf Bildern zu suchen. Darstellungen von Adam und Eva blieben erstmal die Ausnahme. Klar gab es weitere Ausreißer, Kunsthistoriker*innen entdecken immer neue kuriose Fälle, beispielsweise Orgiendarstellungen auf romanischen Kirchenfassaden. Aber sie sind gerade deswegen kurios, weil die kanonische Kunstgeschichte sie verschwieg.
Mit der Renaissance kam eine weitere Lockerung: Nacktheit geht klar – solange das Motiv biblisch oder mythologisch ist. Die ganzen Putti als nackte Baby-Engelchen fielen unter diese Ausnahme. Und bei Allegorien wie z.B. Vanitas-Darstellungen ging es in Ordnung.
Von wegen natürliche Nacktheit
Jahrhunderte lang spielten Künstlerinnen und Künstler nach diesen Regeln. Und es ist doch wirklich fragwürdig, Nacktheit in einem kunsthistorischen Rahmen frei von sexistischen Parametern zu betrachten, denn es ist ein in erster Linie männlicher, patriarchaler, objektivierender Blick, der jahrhundertelang Körperbilder prägte.
Der Kunsthistoriker John Berger unterscheidet zwischen Nacktheit und Entbößtheit: Nackt sein heißt, man selbst sein. Entblößt sein heißt, von Anderen nackt und nicht als man selbst gesehen zu werden. Ein Bild ist ein Objekt, und der entblößte Körper im Bild wird somit ebenfalls zum Objekt degradiert. Der nackte Körper dient nicht dem Selbstzweck, sondern der Betrachtung.
Aktdarstellungen spiegelten in der westlichen Kunstgeschichte meist patriarchale Schönheitsideale wider. Zu Zeiten von Peter Paul Rubens waren Kurven und Volumen in. In der Ära von Jean-Auguste-Dominique Ingres waren es die ein oder zwei Wirbel mehr, die dem weiblichen Körper den ganz besonderen Charm verliehen – da konnten sich die Künstler ganz besonders an unrealistischen Körperbildern austoben!
Ach ja, und da ist noch ein kleiner Double Standard: Männliche Aktdarstellungen hatten nie, im Gegensatz zu weiblichen Darstellungen, schamvoll zu sein. Der nackte Mann ist in der Kunstgeschichte antiker Held, göttliches Körperideal und stolzer Krieger. Frauen aber haben sich in ihrer Nacktheit ganz anders zu verhalten. In dem Zusammenhang sagte Olaf zur Bild: „Ich kann nicht nachvollziehen, dass die Venus Medici als sexistisch empfunden werden könnte. Sie ist ja schon vom Typus her eine ‚schamhafte‘ Venus und zeigt keine anbiedernde Nacktheit.“ Es ist doch bezeichnend, dass es mit der Aphrodite pudica einen ganzen Bildtypus dazu gibt, wie die nackte Frau auszusehen hat: schamvoll, sich mit der Hand bedeckend, sich klein machend. Das gilt auch für Göttinnen. Und auch das ist für Olaf kein Grund, Sexismus zu wittern.
Aktdarstellungen waren in einem gewissen Sinne auch schon immer Formen gesellschaftlich und kunsthistorisch legitimierter Pornografie. Klar, sie durfte nicht offensichtlich sein, deshalb bitte nur biblische oder mythologische Motive. Du willst was erotisches fürs Schlafzimmer? Ein Frauenakt auf einem Bett vielleicht? Nenn die Frau Venus und schon stellt dir keiner dumme Fragen! Oder wie wäre es mit einer büßenden Maria Magdalena, der beim Beten die Brüste beinahe aus dem Bild heraus ins Gesicht des Betrachters fallen? Im 16. Jahrhundert rissen sich die Mäzene geradezu darum, den erotischsten Frauenakt zu besitzen und letztendlich sind es sowieso Männer, die die Regeln der guten Moral festlegen: Wer soll schon was sagen, wenn du dir als Kardinal Ippolito de‘ Medici die Venus von Urbino (1538) für dein Schlafzimmer in Auftrag gibst. Oder wenn du als Kardinal Alessandro Farnese Tizian mit einer Danaë (1544) beauftragst und dein Gesandter dir zufrieden mitteilt, dass die Venus von Urbino im Vergleich zu deinem neuen Schatz wie eine prüde Theatine aussehe.² Und da war noch der geschmackvolle Kommentar von Boschini: Ein Gemälde ohne Akt sei wie ein Mahl ohne Brot.³ Ist ja alles ausschließlich für kunsthistorischen Genuss und geistige Stimulation, versteht sich …
Wäre Nacktheit immer so als natürlich und menschlich angesehen und nicht sexistisch, wie Olaf behauptet, dann hätte man doch nie ein Problem damit gehabt, Künstlerinnen zum Aktzeichnen zuzulassen. Aber so natürlich war Nacktheit dann doch nicht, das wollte man den zerbrechlichen Gemütern nicht zutrauen. Und es wäre für Frauen keine Schande gewesen, für einen Künstler Akt zu stehen (diese Arbeit war für Menschen an den Rändern der Gesellschaft bestimmt: Als Mensch wertlos, als Abbild unbezahlbar). Und dann hätte Gustave Courbets Nahansicht einer Vulva, der L’Origine du Monde (1866), keinen Skandal ausgelöst. Und keiner hätte bei Eduard Manets Olympia (1863), die als Sexarbeiterin weder Göttin noch Gottesmutter war und selbstsicher dem männlichen Blick die Stirn bot, die Augenbraue gehoben. Künstler*innen der Moderne wandten sich von den alten Spielregeln ab und zeigten Menschen in ihrer echten Nacktheit: ungeschönt, unadelig, ungöttlich – und machten genau damit auf jenen kunsthistorischen und gesellschaftlichen Sexismus aufmerksam, den Olaf nun aus dem Nichts heraufbeschworen sieht.
Wäre diese kunsthistorische Nacktheit kein Sexismus, dann hätte sich 2021 niemand über Juliana Notaris als Vulva geformte Land Art Skulptur Diva aufgeregt. Und die Guerilla Girls hätten sich 1989 ganz umsonst echauffiert, dass Künstlerinnen nur 5% der Sammlung des Metropolitan Museum of Art ausmachten, 85% der Aktdarstellungen jedoch von weiblichen Körpern sind. Wer also glaubt, dass diese Kunstgeschichte nicht sexistisch sei, soll sich als Erster seiner Kleidung entledigen.

Unbekannt: Statue of crouching Aphrodite (‚Lely’s Venus‘), 2. Jh. n. Chr. (Kopie), Marmor, 1,12 m; London: British Museum; Foto: Marie-Lan Nguyen (2011), CC BY 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15511559