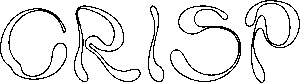Es gab eine Zeit in meinem Leben, da habe ich vier Jahre hintereinander Urlaub auf Ibiza gemacht. Mit Freunden haben wir uns eine Finca gemietet und uns Jahr für Jahr ein bisschen ibizenkischer gefühlt. Haben Clubs, Restaurants, Strände kennengelernt – nur eines blieb immer gleich: die Kunst an den Wänden unserer Miet-Villen.
Es war Kunst, die ich ganz simpel als „Ibiza-Kunst“ bezeichnen würde. Auch wenn sie genauso gut auf Mallorca oder Mykonos hängen könnte. Etwas zu große Werke mit weichen Formen und kräftigen Farben (blau, gelb oder lila, meistens aber blau). Große Gesichter oder schemenhafte Körper, die sich über die Leinwand wölbten oder gar funkelten. Durch Spiegel, die eingeklebt waren. Oder durch das Gelb, das eigentlich schon ins Goldene ging.
Jetzt hat der Großmeister dieser Kunst, Leon Löwentraut, eine 75-minütige ARD-Doku bekommen. Und man fragt sich als Allererstes: Hat es diese Doku gebraucht? Vermutlich nicht. Dafür ist die von Philipp Lutz produzierte Dokumentation aber ganz schön gut gelungen. Vielleicht ein Grund, etwas genauer hinzusehen.
Leon Löwentraut wurde ca. 2020 der Öffentlichkeit bekannt. Es hieß, ein Wunderkind erobere die Kunstszene, ein Picasso aus dem Frühstücksfernsehen. Ich erinnere mich an Bilder, in denen der noch junge Künstler mit Yeezies und zerschlissenen Jeans auf Vernissagen von Düsseldorfer Kö-Galerien posierte.
Leon Löwentraut. Genie oder Einbildung © ARD Kultur, Lutzfilm, Maike Angelina Simon.
Eine Welt, die mir durch meine Arbeit in der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen zumindest geografisch nicht weit entfernt war. Zu dieser Zeit nahmen mein Umfeld und ich beinahe reflexhaft eine Anti-Haltung zu ihm und seiner Kunst ein. Wie sollte man jemanden ernst nehmen, der bunte Kunst für ein Vergnügungs-Publikum machte?
Werke mit kreisrunden Motiven, die man zwar wiedererkannte, die aber auch schnell eintönig wurden. Mit einem Stil, der eine Mischung aus Comic und KI anmuten ließ. „Bisschen Picasso, bisschen Matisse, bisschen Pollock, also eine relativ gefällige Mischung“, urteilt der Kunstkritiker Hanno Lauterbach in der Doku.
Gleichzeitig erinnere ich mich daran, wie ein kunstferner Freund einmal unironisch zu mir meinte: „Diesen Löwentraut find’ ich cool. Er trägt Yeezies und wirkt irgendwie zugänglicher als so klassische Künstler.“ Seit diesem Satz versuche ich möglichst auch die Gegenseite beim Phänomen Löwentraut zu sehen. Ein Ansatz, den glücklicherweise auch der Film verfolgt.
Überhaupt hält sich die Produktion bei Einordnungen zurück. Lässt stattdessen – ganz nach heutiger Doku-Manier – die einzelnen Protagonist*innen zu Wort kommen. Da ist auf der einen Seite Löwentrauts Entourage, angeführt vom Vertriebler-Vater und der „Ich bin eine Löwin“-Mutter. Und auf der anderen Seite die beiden Kunstkritiker Lauterbach und Hajo Schiff. Ein paar mehr unabhängige Stimmen hätten sicher nicht geschadet.

Leon Löwentraut. Genie oder Einbildung © ARD Kultur, Lutzfilm, Maike Angelina Simon.
Tatsächlich ist dem Künstler viel an seiner „Zugänglichkeit“ gelegen, wie die Doku gekonnt herausarbeitet – zumindest, wenn man darunter auch seine Selbstvermarktung versteht. Denn die scheint Löwentraut fast schon wichtiger als seine Kunst selbst. Immer wieder beteuert er, dass Kunst unbedingt auch die Inszenierung brauche, gerade in Zeiten wie diesen.
Daraufhin werden Szenen eingeblendet, bei denen man nicht anders kann, als mit dem Mundwinkel zu zucken. Etwa, wenn Löwentraut zu seiner Ibiza-Eröffnung mit einem Helikopter angeflogen kommt. Umringt von tanzenden und trommelnden Cyber-Figuren streift er durch das Publikum und verzieht rockstaresk keine Miene. Den lila Suitsupply-Doppelreiher bis auf Anschlag zugeknöpft.
WTF-Momente wie diese hatte ich zuletzt mit 22, als ich erfuhr, dass ein amerikanischer Künstler namens Jeff Koons weltbekannt wurde, indem er Staubsauger in Museen ausstellte. Nur schien mir das ein paar Jahre später im Kontext der Kunstgeschichte dann doch recht einleuchtend. Denn das hatte zuvor niemand gemacht.
Auch für Löwentraut ist die Kunstgeschichte ein zentrales Thema. Er hoffe, spricht er schuljungenhaft in die Kamera, dass er am Ende seines Lebens weltbekannt sei, jeder seine Werke kenne und sie in allen großen Museen hingen. Mein 22-jähriges Ich muss kurz schlucken – so viel Selbstbewusstsein, wenn auch etwas künstlich zusammengeschustert, hört man nicht mal bei den ultimativsten Gen-Zs.
Zugegeben, es ist leicht, Löwentrauts Kunst als gehaltlos abzutun. Doch steckt in diesem unbedingten Willen, anerkannt zu werden, die vielleicht interessanteste Facette seines Wesens. Ob Ablehnung durch die Düsseldorfer Kunstakademie, ob Zerrisse von Feuilletons – dieser junge Typ zeigt einen löwenharten Willen, wenn es darum geht, es seinen Gegnern zu beweisen. Man fragt sich nur, wie.
In zeitgemäßem Look fängt die Doku ein, wie er in seinem Atelier in Portugal oberkörperfrei über einer Leinwand kniet. Wie er immer mehr Farbe drauf klatscht, wie er bei jedem Pinselstrich, seinem “Trademark“, noch schwerer atmet. Am Ende entsteht dann aber doch nur ein ziemlich beliebiges Strandgemälde – mit viel blau und goldenem Sand.

Leon Löwentraut. Genie oder Einbildung © ARD Kultur, Lutzfilm, Maike Angelina Simon.
Mehrmals frage ich mich beim Zusehen: Was, wenn Löwentraut all seine Kraft nicht in die Inszenierung, sondern in seine Inhalte stecken würde. Wenn er, wie meine Kunstgeschichte-Professorin zu sagen pflegte, ein Thema wirklich penetrieren würde. So wie es institutionell etablierte Künstler eben tun.
Doch dann, als er wieder eine Künstlerphrase nach der anderen von sich gibt, beinahe wie ein Talking-Head in Reality-Shows, fällt mir auf, dass er eigentlich eine Sache mehr durchdringt als die allermeisten anderen: den Wunsch, Künstler zu sein.
Vielleicht, so bringt es der Kunstkritiker Schiff in diesem lohnenswerten Film auf den Punkt, wird es Leon Löwentraut als erster Künstler nicht durch seine Kunst ins Museum schaffen, sondern durch seine Ambition.