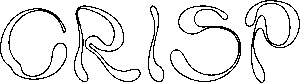Die Künstlerin und Kuratorin Lisa Bergmann kämpft seit Jahren für die Einführung einer rechtlich verpflichtenden Ausstellungvergütung für freie Künstler*innen ein. Diese sieht vor, dass Künstler*innen, die ihre Kunst einem Museum für eine Ausstellung zur Verfügung stellen, in Form von Honoraren bezahlt werden. Dadurch wäre endlich eine gerechte und angemessene Vergütung auf dem sonst harten Kunstmarkt gewährleistet.
Wir treffen Lisa Bergmann in ihrem Atelier im Kulturzentrum Tempel in Karlsruhe und wollen mehr über die Dringlichkeit von Ausstellungsvergütungen wissen. Bei Kaffee und chinesischen Süßigkeiten erzählt Lisa Bergmann was Ausstellungshonorare für Künstler*innen, Kunst und Gesellschaft bedeuten würden.
Crisp: Was ist deine Forderung an die Kunstbranche?
Lisa Bergmann: Künstler*innen werden für ihre angefragten Leistungen immer noch nicht vergütet. Deshalb braucht es eine gesetzliche Verpflichtung, bildenden Künstler*innen Ausstellungshonorare zu zahlen. Sobald diese gesetzliche Verpflichtung da ist, wird sich jeder und jede daranhalten müssen. Die Ausstellungsbudgets werden dann an diese Verpflichtung angepasst. Wenn es an Geld fehlt, kann Druck von den Kunstinstitutionen, Künstler*innen und Besucher*innen auf die öffentliche Hand gemeinsam ausgeübt werden. Man darf die Künstler*innen aber nicht mit ihren Forderungen allein lassen. Wir sehen, dass ohne Verpflichtung keine Unterstützung von jenen Institutionen kommt, die sich eigentlich um die Künstler*innen kümmern sollten. Und tragischerweise erschwert die prekäre finanzielle Situation von Künstler*innen gleichzeitig ihre politische Arbeit. Über die Zweitjobs hinaus, mit denen Künstler*innen ihren Unterhalt finanzieren, fehlt leider oft die Zeit für ein ehrenamtliches Engagement in einem Verband.
War denn die Vergütung von Künstler*innen schon immer ein Problem?
Das Problem der fehlenden Entlohnung für Künstler*innen entsteht mit dem 19. Jahrhundert, als sich Kunstvereine gegründet haben. Davor konnten nur jene Menschen Kunst genießen, die die finanziellen Mittel hatten, Künstler*innen für ihre Dienste zu bezahlen, und das waren vor allem Adelige. Vom Bürgertum gegründet, hatten die Kunstvereine das Ziel, die Kunst den Bürger*innen zugänglich zu machen. Im Zuge der Etablierung öffentlicher Kunstausstellungen wurde jedoch nicht das Entlohnungssystem mit angepasst. Früher haben Kunstvereine sich noch darum bemüht, Käufer*innen für die ausgestellten Werke zu finden, man hat Ausstellungen für den Verkauf organisiert. Das ist heute nicht mehr so. Ausstellungen werden immer diskursiver konzentrieren sich auf einen Inhalt. So bieten Bildende Künstler*innen ihre Dienstleistung an, stellen ihr Können und Wissen zur Verfügung ohne dafür eine Gage zu erhalten. Es gab in der Vergangenheit bereits einige Versuche, eine Vergütung für Künstler*innen einzuführen, die aber immer wieder von politischer oder institutioneller Seite abgeschmettert wurden.
Wie würde denn eine Ausstellungsvergütung für Künstler*innen konkret aussehen?
Es gilt ein Modell zu finden, um die Ausstellungsvergütung möglichst einfach und einheitlich auf unterschiedliche Institutionen und Ausstellungssituationen anwenden zu können. In der AG Gerechte Bezahlung des Bündnisses für gerechte Kunst– und Kulturarbeit erscheint uns ein Mindestanteil von 20 Prozent der Projektkosten als Ausstellungsvergütung gut umsetzbar. Im Gegensatz zu anderen Modellen, ist es leicht planbar. Zudem gibt es für diese Richtwerte Vorbilder in anderen gestalterischen Branchen wie der Architektur. Als Künstler*in ist es immens wichtig, die eigenen Arbeitsrechte zu kennen und auf diese zu bestehen. Das betrifft auch das Urheberrecht, in dem steht, dass urheberrechtliche Leistungen angemessen vergütet werden müssen. Eine Demokratie braucht lohnrechtliche Mindeststandards. Dabei lohnt sich ein Blick in andere Berufsfelder, in denen vor allem Selbstständige tätig sind, wie der Fotografie, Architektur oder auch bei Anwält*innen – dort gelten aus gutem Grund gesetzliche Verordnungen bezüglich Mindesthonoraren.
Die Bildende Kunst darf sich nicht klein machen. Sie muss zeigen, dass sie für die Gesellschaft wichtig ist und dafür auch eine Gegenleistung bekommen. Sie kann selbstbewusst vor die Politik treten und sagen, dass sie beispielsweise für das Image und die Lebensqualität jeder Stadt und Region unerlässlich ist.
Du setzt dich vor allem für eine bessere finanzielle Unterstützung der freien Szene in der Bildenden Kunst ein. Warum ist es nötig diese Szene staatlich zu unterstützen?
Es ist geschichtliche Genese, dass sich die Kunstbranche die Nische des sehr hochpreisigen Segmentes gesucht hat. Kunst hat sich mittlerweile als eine Art Luxusgut positioniert. Mir wäre es viel sympathischer, wenn sich Kunst nicht nur an eine elitäre Schicht wendet, sondern an alle. Wenn man den Vergleich zu den Darstellenden Künsten, also dem Theater, heranzieht, sieht man, dass dieser Bereich öffentlich gut finanziert wird – neben den kommunalen Theatern werden dankenswerterweise auch die freien Bühnen sehr ernst genommen. In diesem Bereich erkennen die Bundesländer den hohen Bedarf und die Nachfrage der Bevölkerung an den Darstellenden Künsten. Für freie Kunstprojekte hingegen gibt es kaum öffentliche finanzielle Unterstützung. Aber gerade dort, in Off-Spaces, in selbstorganisierten Projekten und im Öffentlichen Raum sind selbstständige Künstler*innen tätig, die Kunst einer größeren Bevölkerungsschicht zugänglich machen. Das Ungleichgewicht in der finanziellen Ausstattung der Künste steht der Tatsache entgegen, dass die Bildende Kunst für alle erreichbar sein kann.
Wer trägt denn die Verantwortung für die prekäre finanzielle Situation der Künstler*innen – die Kommunal- oder die Bundespolitik?
Die kommunalen Kunstinstitutionen könnten mit der Förderung, die sie im Moment bekommen, sofort alles ändern, verweisen aber stets darauf, dass sie mehr Geld von der Kommunalpolitik brauchen. Die Kommunalpolitik wiederum schiebt die Verantwortung an die Bundespolitik, mit der Begründung, dass das Geld im Haushalt zu knapp sei. Diese Argumentation funktioniert so einfach nicht. Als der Mindestlohn eingeführt wurde, haben die Unternehmen auch nicht mehr vom Staat bekommen, sondern der Mindestlohn wurde einfach gesetzlich verpflichtend eingeführt. Nun müssen Unternehmen schauen, dass sie ihre Planung bzw. ihr Management auf die Gewährleistung eines grundlegenden Minimalgehalts ausrichten. Natürlich verschieben sich Dinge dadurch, aber es hat die deutsche Wirtschaft nicht zum Ruin geführt und es wird auch die deutsche Kulturlandschaft nicht in den Ruin führen, wenn eine Ausstellungsvergütung für Künstler*innen eingeführt werden würde. Ganz im Gegenteil. Die Geschichte des Arbeitskampfes hat gelehrt, dass Branchen gestärkt werden, sobald Arbeitsrechte gelten und gesetzliche Vorgaben eingehalten werden. Eine permanente Unterbietung der Konkurrenz hingegen schwächt Arbeitsfelder und verhindert den Aufbau eines gesunden, nachhaltigen, langfristigen und vor allem krisenfesten Arbeitsfeldes.
Aber auch Kunsthochschulen, Professor*innen sowie Verbände tragen eine wichtige Verantwortung in dieser Situation.
Nun gibt es ja auch in der Bildenden Kunst Berufsverbände. Was ist eigentlich deren Rolle?
Die Aufgabe von Berufsverbänden der freien Kunst, ist es, die Interessen und Rechte der berufstätigen Künstler*innen zu verlautbaren sowie Kunst im Interesse der Bevölkerung erreichbar zu machen. Sie sollten ihre Aufgabe als politische Organe und Ansprechpartner*innen für die Politik aber auch wahrnehmen. Da gilt es laut und selbstbewusst zu äußern, was Künstler*innen brauchen.
Idealerweise sollten alle Künstler*innen in Verbände eintreten und dafür einstehen, dass ihre Wünsche geäußert werden. Je größer ein Verband, desto leichter können Forderungen auf politischer Ebene durchgesetzt werden. Und noch etwas können Künstler*innen tun: gemeinsam streiken und Zusammenhalt zeigen.
Nach unserem Gespräch klingt für mich die Umsetzung einer Ausstellungsvergütung absolut selbstverständlich. Woran scheitert es?
Wenn man möchte, dass Künstler*innen gesund leben und ihre Kunst langfristig entfalten können, müssen Kunstinstitutionen und die Kommunalpolitik den Willen entwickeln, ein gerechteres Arbeitsumfeld für Künstler*innen zu schaffen. Mein Wunsch ist es, dass man die freie Szene der Bildenden Kunst als genauso gleichwertig ansieht, wie die freie Szene der Darstellenden Kunst. Dort passiert nämlich am meisten Innovation.
Wir müssen uns stets klar machen, dass die jetzige Situation der Künstler*innen bestimmt, welche Kunst wir in Ausstellungen zu sehen bekommen. Können auch Menschen jenseits der wohlhabenden Schichten Kunst erzeugen und sich beispielsweise trotzdem leisten, eine Familie zu gründen? Wer kann Kunst produzieren und wer darf an ihr teilhaben? Meine Überzeugung ist, dass durch eine Ausstellungsvergütung sowie die Finanzierung der freien Szene auch die Kunst in Ausstellungen für alle interessanter wird.