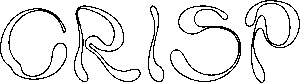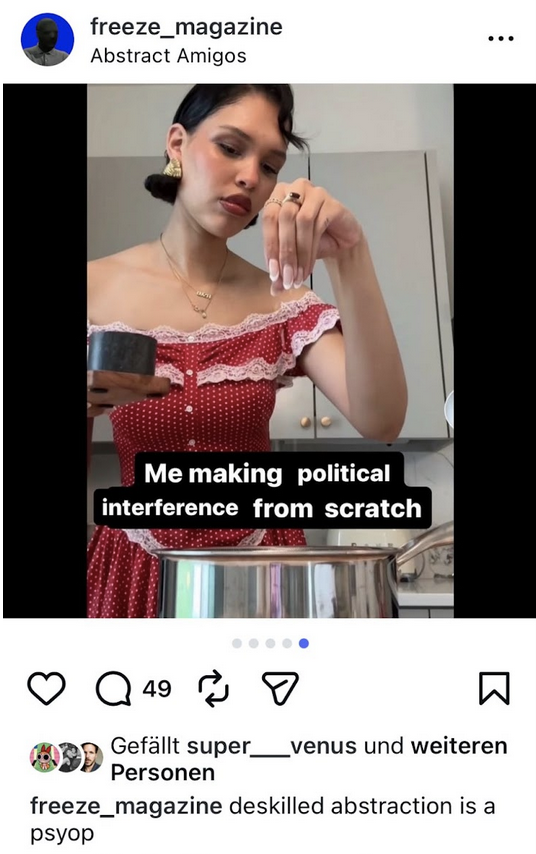„Bewegte Gesichter altern nicht“, sagt meine Freundin A. „Je weniger du greifbar bist, je weniger dein Gesicht nur eine einzige Persönlichkeit ausdrückt, desto weniger sieht man dir an, wie du älter wirst. Stattdessen bleibst du eben einfach in Bewegung.“ A. sagt das im Verhältnis zu den Regeln der Normativität, die sie ablehnt. Sie sagt es im Verhältnis zu unserer gemeinsamen Freundin B., die sich erfolgreich vorgenommen hat, nicht zu lächeln, wenn die Sonne scheint, weil man dann besonders schnell Falten bekommt. Und die immer einen riesigen Sonnenhut trägt, selbst im Herbst noch. Der Sonnenhut steht ihr gut, das denken wir beide, aber ihr faltenloses, makelloses Gesicht wirkt seltsam wächsern.
Ich erinnere mich an A.s Ausspruch, als J. sagt, dass es schwierig werden könnte, mich auf der Leinwand abzubilden – denn mein Gesicht wäre so bewegt. „Vielleicht gibt es keinen einzigen Ausdruck, der repräsentativ ist, für deinen Charakter“, sagt er – vielleicht müsste man mehrere zeigen. Und ich erinnere mich an eine Malerei vom späten Tizian, bei der ein Schäfer neben einer nackten Nymphe sitzt und sich halb abwendet, im Hintergrund aber sieht man noch eine dritte, eine Geisterhand, die die Nymphe umfängt – es ist die Hand, die den Wunsch des Schäfer ausdrückt, ebenjene Göttin zu berühren. Der Wunsch bleibt unerfüllt, aber Tizian erfüllt ihn ihm, indem er jene Geisterhand zur Komposition hinzufügt.
Die Zeit vergeht auf seltsame Weise, während ich auf dem Sofa sitze, J. gegenüber. Die liegende Pose war uns zu lasziv vorgekommen, obwohl die Stimmung sehr nüchtern ist. Es ist das Problem des Kanons, mit dem wir konfrontiert sind.
Ich sitze also auf dem Sofa, J. sitzt mir gegenüber. Er putzt seine Pinsel mit einem Geschirrhandtuch, es macht ein Geräusch, so unangenehm, dass sich meine unsichtbaren Haare sträuben.
Draußen scheint die Sonne, es ist ein wunderschöner Tag. Ich bin froh, dass ich einen guten Grund habe, ihn nicht im Freien zu verbringen: Ich bin eine notorische Stubenhockerin. Vielleicht bin ich deshalb Autorin geworden, denke ich. Um einen guten Grund zu haben, Zuhause zu bleiben, wenn alle anderen das Haus verlassen. Manchmal rühme ich mich damit, dass dunkle Jahreszeiten und schlechtes Wetter mich unbeeindruckt lassen. Es ist zumindest fast wahr.
Ob J. das so ähnlich geht, weiß ich nicht, aber er hat sich jedenfalls eine ähnlich einsame Tätigkeit ausgesucht. Es gibt einiges, was Maler:innen und Schreibende verbindet: Wir verbringen viel Zeit allein, im Zwiegespräch mit der Leinwand, dem gefürchteten weißen Blatt Papier. Die Farbe weiß bildet den Grund für die Welten, die wir schaffen. Wir befinden uns unweigerlich in Gesellschaft all derer, die vor uns geschrieben und gemalt haben: die unterrepräsentierten von ihnen ebenso omnipräsent wie die, die es in den Kanon geschafft haben. Ein Bezugssystem, das wir immer wieder vergessen müssen, sonst würde es uns von der Arbeit abhalten. Eines, das dennoch anwesend bleibt, im Unbewussten. Wir schreiben uns, mit Pinsel und Tastatur, ein in eine lange Tradition. Unsere eigene Position darin ist so wenig zufällig wie sie uns selbst verborgen bleiben muss: Zu genau zu wissen was man tut, steht der Idee der täglichen Atelier- oder Schreibtischpraxis entgegen.
Wir beide sind, in unserer professionellen Funktion, Einzelgängerinnen, die sich ab und zu zeigen müssen. Der Kontrast zwischen der fast eremitischen, in sich selbst zurückgezogenen Praxis und dem selteneren Moment der Repräsentation, auf die die Arbeit hinausläuft (die Lesung, die Ausstellungseröffnung) könnte größer kaum sein – er hat fast schizophrene Natur.
Einmal in der Stunde piept meine blaue Casio Uhr. Das Piepen kann ich nicht ausstellen, deshalb bleibt die Uhr nachts immer so weit wie möglich von meinem Bett entfernt. Weil ich auch nicht weiß, wie man sie umstellt, habe ich eine Casio für die Sommerzeit und eine für die Winterzeit. Um Mitternacht piept die Uhr besonders laut – spätestens dann weiß ich, dass Schlafenszeit ist. Das Piepen hat etwas Manisches.
Anfangs kommen mir die Abstände zwischen dem stündlichen Piepen noch besonders lang vor, mit jeder Stunde dann ein wenig kürzer. Die Diskrepanz zwischen tatsächlich vergangener Zeit und „gefühlter“ Zeit ist eines der Logikprobleme meiner, unserer Gegenwart; die Konstruktion von Zeit etwas zutiefst Kapitalistisches. Manchmal frage ich mich, ob sie tatsächlich existiert, diese scheinbar verbindliche Zeit – so relativ kommt sie mir vor. Dann kann ich sie nur in ihrer Funktion, uns zum Arbeiten anzustiften, wahrnehmen. Hier auf dem Sofa, das ebenfalls buchstäblich „aus der Zeit gefallen“ zu sein scheint, verschwimmt sie ein bißchen, offenbart sich in ihrer ganz somatischen Relativität.
J. und ich haben Blickkontakt – er ist anders als jede Art Blickkontakt, die ich kenne. Nüchtern, weniger bedeutungsschwanger, als in jeder anderen Situation – und dabei unglaublich genau. Noch nie hat mir jemand so tief in die Augen geschaut, ohne mir dabei etwas Bestimmtes sagen zu wollen.

Olga Hohmann, porträtiert von Joachim Lenz, 2025
Irgendwann stehe ich auf und hole uns Heißgetränke von nebenan. Es ist die Art Getränk, die es erst seit einigen Jahren in der Stadt gibt – es ist ein Versuch, von meiner Seite, die Nostalgie zu brechen, die kaum zu ertragen ist. Obwohl: Ist nicht alles, was in der Gegenwart passiert, notgedrungen „gegenwärtig“, „contemporary“, einfach, weil es in der Gegenwart passiert und nicht in einer anderen Zeit? Und: Ist man nicht ohnehin immer mindestens einen Schritt zu langsam, wenn man versucht, „in der Gegenwart“ zu sein?
Am Telefon hatte F. gesagt, dass man „gute Malerei“ daran erkenne, dass ein einziger Ausschnitt, ein Rechteck, wie man es mit zwei Händen beschreibt, die ganze Komplexität der gesamten Leinwand in sich trägt. Pars pro toto – ein Teil beschreibt das Ganze.
Natürlich traue ich mich selten, zu schauen, was dort passiert, auf der anderen Seite der Leinwand. Manchmal ruft J. aus ich sähe plötzlich aus wie eine alte Frau, manchmal ärgert er sich, dass ich zu ernst aussehe und kommentiert das dann direkt: „Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn ein Mann zu einer Frau sagt ‚Lächel doch mal!‘“. Ich frage mich, ob der Maler in seiner fast hellseherischen, in seiner Genauigkeit irgendwie metaphysisch-beschwörenden Funktion, vielleicht erkennt, dass mein „wahrer Charakter“ in Wirklichkeit gar kein so sympathischer, lustiger ist, wie ich hoffe, es zu vermitteln. So wie wenn ein Haustier oder ein kleines Kind anfängt zu weinen, wenn es einen kennenlernt und man vermutet, sie hätten etwas in einem gesehen, was den Erwachsenen verborgen bleibt.
Die größte Frage, die immer wieder auftaucht, ist die nach dem Generischen und dem Spezifischen. Ich sähe zu wenig spezifisch aus, meine Eigenheit würde sich nicht vermitteln, sagt J. immer wieder und wischt mit Terpentin über die Leinwand, so dass große beige Flecken entstehen. Dann fragt er sich wieder, ob es wohl unmöglich ist, mich einzufangen, als „ganzen Menschen“, wenn man nur einen einzigen Ausdruck wählt, statt vieler, die sich schnell hintereinander ablösen. Neulich, als ein befreundeter Arzt mir Botox gegen die Stirnfalten anbot, nicht zuletzt weil es „gut gegen melancholische Verstimmung“ sein soll, war es genau das, was mich davon abhielt, auf das Angebot einzugehen: Die Unmöglichkeit, mit den Augenbrauen Ambiguitäten auszudrücken.
Ich antworte J., dass die Frage nach dem Generischen und dem Spezifischen ohnehin durchaus allgegenwärtig sein – ständig werde ich darauf angesprochen, dass jemand mal wieder „eine Doppelgängerin“ von mir gesehen hätte. Oder im Gegenteil: Fremde kommen auf mich zu, fassungslos, und behaupten, ich wäre das genaue Abbild ihrer Freundin soundso. Die jeweiligen Menschen, die die Ähnlichkeit entdecken, sind dabei meistens völlig eingenommen von der Erkenntnis, während man selbst nicht viel damit anfangen kann, man kennt die betreffende Person ja gar nicht. Dennoch: Es gibt kaum ein Spiel, das die Eitelkeit stärker befriedigt, als die Frage danach, welchem Celebrity man ähnlich sieht.
Dass J. mit der Farbe Beige beginnt, um die Umrisse zu zeichnen, gefällt mir. Als Kind war es mein größter Minderwertigkeitskomplex, dass alles an mir beige zu sein schien: Haare, Haut und Augen. Kaum Kontraste. Lieber hätte ich ausgesehen wie Schneewittchen – aber das Gegenteil war mir vergönnt. Irgendwann freundete ich mich mit der Eigenschaft Ton-in-Ton zu sein an, eignete sie mir quasi an und unterstützte sie noch, indem ich mich zusätzlich beige kleidete.
Während J. unsichtbar durch die Oberfläche der Leinwand navigiert – die Farbpaletten fungieren als Landkarte – frage ich mich, ob nicht jedes Porträt in erster Linie das Porträt des Malers ist. Ebenfalls eine Verbindung zum Schreiben: Man eignet sich, malend, schreibend, das Narrativ über die eigene Umgebung an. Vor allem dann, wenn man sich ausgeliefert fühlt, kann diese Aneignung ein befreiendes, ein empowerndes, selbstermächtigendes Moment haben: J. erzählt, er fing damit an, in der Schule die Lehrerin:innen, die Autoritäten zu porträtieren.
Auf dem Sofa sitzend, der Heizstrahler direkt vor mir, frage ich mich also: Ist jedes Porträt in erster Linie ein Selbstporträt der Maler:in? Ein verrückter Gedanke, wenn man daran denkt, wie viele historische Gemälde im höfischen Kontext entstanden, oder im christlichen. In beiden Fällen ging es nicht um die Subjektivität der jeweiligen Maler:in – dennoch spiegelte sie sich in ihnen: Velazquez charakteristische Eigenart spiegelt sich in den Röcken der „Meninas“.
Wie genau das Kräfteverhältnis zwischen Künstler:in und Porträtierten gelagert ist, ist komplex. J. erzählt, dass er seinen Sohn dafür bezahlen musste, sich von ihm porträtieren zu lassen. Um sein Taschengeld aufzufrischen, saß er nun seinem Vater Modell. Jener Sohn schaut mich an, während ich dort auf dem Sofa sitze, zweimal sogar – in sehr großem und in sehr kleinem Format. Es erinnert mich fast an die Gemälde, deren Augen, deren Blick, einem immer zu folgen scheinen, ganz gleich, in welchem Teil des Raumes man sich befindet. „Je größer die Leinwand ist, desto kleiner wird der Ausschnitt“, sagt J. und ärgert sich, dass er meine orangefarbenen Socken nicht mit aufs Bild bekommt – denn sie passen doch so gut zu den orangefarbenen, frisch manikürten Fingernägeln.
Ich denke an Henri Matisse, der manchmal monatelang auf ein Modell wartete, weil es ihm unmöglich schien, eine andere Person zu porträtieren. So wartete er zum Beispiel fast ein halbes Jahr auf eine reiche Amerikanerin, von der er bisher nur ein Foto gesehen hatte, und die den Termin immer wieder verschob, weil sie stattdessen in Sankt Moritz feierte. Während er wartete, kaufte er auf dem Markt immer mehr Ziervögel, deren Farben ihn inspirierten und ihn darauf vorbereiten sollten, jenes Modell möglichst spezifisch abzubilden.
Mittlerweile habe ich nun doch die Position gewechselt, nicht zuletzt aus der leichten Erschöpfung heraus: Jede Position kann ermüden, wenn man sie lange halten muss, stelle ich fest, egal, welche es ist, egal, wie bequem sie anfangs scheint. Dadurch, dass J. nun sitzt – und nicht mehr steht – ist das Verhältnis zu mir, die ich nun liege, nicht unangenehm. Im Gegenteil: Wir sind buchstäblich auf Augenhöhe.
Im Geruch von Ölfarbe, Terpentin und Walnussöl liegend, frage ich mich, warum ich eigentlich so furchtlos bin, wenn es um mein eigenes Porträt geht: Irgendwie habe ich mich damit abgefunden, dass das Unsichtbare, das auf der anderen Leinwandseite erscheinen wird, mindestens ebenso sehr ein Porträt von J. selbst ist, wie von mir. Es zeigt eine von vielen „Wahrheiten“, eine Perspektive auf mein Gesicht, eine einzige Form, das Bewegte still zu stellen, die an einem anderen Tag, durch eine andere Linse, eine ganz andere sein könnte. Und so kann ich tatsächlich ein wenig „loslassen“, im streng nicht-esoterischen Sinne, auf dieser unaufdringlichen, leichten Ledercouch. Ich frage mich, ob ich etwas benebelt bin von den giftigen Dämpfen, die, so sagt man, für manche historische Maler:in, den frühen Tod bedeutet hat. Sigmar Polke, der sowohl als Chemiker als auch als Alchemist unter den Maler:innen galt, hat sich, so vermutet man, buchstäblich an den Dämpfen, die seine Malerei erzeugten, vergiftet.
J. wischt die Ölfarbe immer nur an einem Hosenbein ab. In der Ecke des Raumes liegen seine Straßenkleider, im Kreuzberger Atelier trägt er verschiedene Paare Jeans, die alle nur rechts von Ölfarbe verschmutzt sind. Eine Eigenart, die mich beschäftigt – so wie meine Mäntel nur auf der linken Schulter verschließen, weil ich die Handtasche immer auf der selben Seite trage. Und dann sagt er etwas, das mich beruhigt: „Bis die Malerei vollständig getrocknet ist, dauert es Jahre.“ Sie ist also im Werden begriffen, bleibt unfertig, im Prozess, selbst wenn sie unangetastet bleibt – so wie unsere Körper, die, selbst im Ruhezustand immer in Bewegung bleiben. Die Zellen erneuern sich täglich, stündlich, im Sekundentakt – und so ist ein Porträt immer mehr, als (nur) ein Abbild. Es ist auch ein Selbstporträt der Maler:in, es ist ein vergänglicher Blick auf einen vergänglichen Menschen, in einem höchst vergänglichen Moment. Und es arbeitet weiter, arbeitet vor sich hin, selbst wenn der letzte Pinselstrich getan ist.