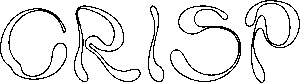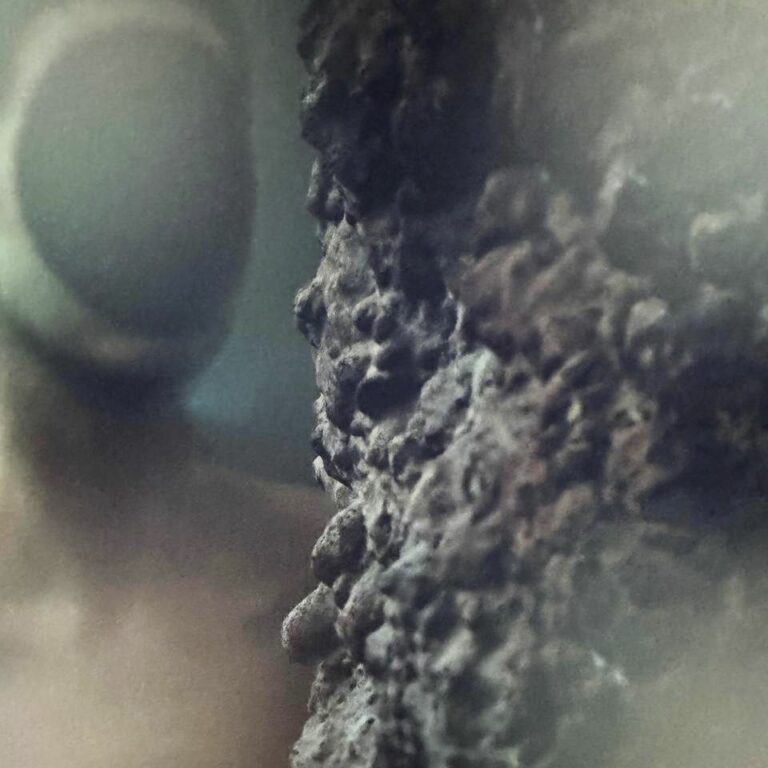Die Stulpen werden noch mal hochgezogen und dann geht es los, zwei Teams, zwei Tore, ein Ball. Es wird gejohlt, der Schiedsrichter pfeift, alles ist wie immer, nur: Die Männer auf dem Feld sind nackt. Wir befinden uns nicht auf der Berliner Fanmeile, sondern wenige hundert Meter weiter nördlich, im Haus der Kulturen der Welt. Der Fußball ist überall, auch in der Kunst, zumindest einen Sommer lang. Was macht er da?
Zahlreiche Institutionen für zeitgenössische Kunst und Kultur widmen der Fußball-Europameisterschaft in diesen Wochen ihre Bühnen und Ausstellungsräume. So veranstaltet das Haus der Kulturen der Welt mit „Ballett der Massen“ ein ganzes Sommerprogramm, heute wird die Performance „Portent“ des britischen Künstlers Eddie Peake gezeigt. Die nackten Fußballer spielen in einer Halle, in der vor kurzem noch Gemälde und Fotografien hingen, Klebestreifen markieren das Feld, die Farbe der Stulpen das Team.
Während man nach dem Anpfiff lediglich die Schuhe auf dem Hallenboden quietschen hört – das kunstgeübte Publikum bleibt zunächst gesittet, die Spieler laufen stumm – wird aus der Performance schnell ein tatsächliches Spiel. Die Zuschauenden jubeln, hier und da gibt es eine halbherzige La-Ola-Welle. Die Nacktheit fällt, wie in der Sauna, bald nicht mehr auf. Dass Fußball tiefer als museale Verhaltensnormen sitzt, ist wohl die Aussage dieses Werks. Das ist amüsant und spätestens nach einer halben Stunde etwas langweilig, denn dafür hätte man ja auch ins Stadion gehen oder am Abend den Fernseher einschalten können.
Aber natürlich geht es Eddie Peake um mehr, die Performance handelt von Machismo und Männlichkeit, ohne das überdeutlich inszenieren zu müssen. Das ist smart, man lässt einfach zehn Männer auf dem Feld sich selbst vorführen, der Ehrgeiz bricht auf, die wütenden Gesten Richtung Schiedsrichter sitzen, die Berührungsangst vor dem nackten Körper des Gegners schwindet nur langsam.
Die im kulturellen Gedächtnis fest verankerten Fußballszenen sind untrennbar mit Bildern von Männlichkeit verbunden. In ihrer Fünf-Kanal-Filminstallation „WINNER“, ausgestellt im Hamburger Bahnhof, lässt die Künstlerin Marianna Simnett eine Gruppe von Tänzer*innen ikonische Fouls nachspielen – etwa den Kopfstoß von Zidane gegen Materazzi beim WM-Finale 2006 oder den Tritt von Beckham gegen Simeone im Jahr 1998. Es wird Blut gespuckt, den Oberschenkel ziert eine offene Wunde. Die Brutalität des Spiels mischt sich mit der Eleganz des Tanzes. Auf einem anderen Bildschirm stellen die Performer*innen Hooligans dar, die sich bewegen wie eine Horde Gockel, den Kopf vor und zurück wippend. Die Storyline des Films springt von Leinwand zu Leinwand wie ein Ball. Dass in dem Film kein einziger Fußball zu sehen ist, fällt zunächst gar nicht auf, so assoziiert sind die anderen Aufnahmen: Rasen, Wurst, Bier.
Simnett versteht Fußball als Tanz, der ein popkulturelles Bedürfnis nach vertrauten Choreografien bestätigt. Ähnlich heißt es in dem Stück „Endgame 24“ am Maxim-Gorki-Theater, bei dem Sport ginge es nicht um Tore, sondern darum, die richtigen Bilder zu produzieren. Fußball als Schauspiel. Ein Spiel flexibel genug, dass jede Kunstform sich selbst darin erkennen kann?
„Endgame 24“ von Juri Sternburg (inszeniert von Marco Damghani) handelt von Korruption hinter den Fußballkulissen. Ein großer Teil des Kulturprogramms rund um die UEFA EURO 2024 wird durch die Stiftung Fußball & Kultur EURO 2024 mit Bundesmitteln gefördert, auch wenn – wie in diesem Stück – laut „Fuck UEFA, fuck FIFA“ gerufen wird.
Auf der anderen Seite der Spree wurde im Berliner Ensemble unterdessen „Spielerfrauen“ von Lena Brasch und Sina Martens inszeniert. Sie kamen ohne Finanzierung durch die Fußball-Stiftung aus, womöglich ist daher das Stück einer der kritischsten Beiträge zum EM-Sommer. Es ist Kasia Lenhardt gewidmet, der Ex-Freundin des Starfußballers Jérôme Boateng, die 2021 verstarb. Schon mehrfach wurden Ermittlungen gegen Boateng wegen mutmaßlicher Körperverletzung an Ex-Partnerinnen aufgenommen. Lenhardt soll mit einem non-disclosure Agreement zum Schweigen gebracht worden sein. Mit Anspielungen an sogenannte Spielerfrauen wie Lenhardt, Victoria Beckham oder Cathy Hummels legt die Inszenierung offen, welchem Druck und auch welcher Gewalt sie oft ausgesetzt sind, durch die Presse, ihre Partner, das System Fußball an sich.
In dieser Europameisterschaft steht etwa Cristiano Ronaldo, der vor wenigen Jahren eine Vergewaltigung eingeräumt haben soll, für Portugal auf dem Feld. Während großer Fußballturniere steigt die häusliche Gewalt gegen Frauen an – die britische Studie dazu wird immer wieder zitiert. Es gibt allen Grund, die Spiele mit einem männlichkeitskritischen Kunstprogramm zu begleiten. Gleichzeitig geht es in den Kunstwerken überraschend wenig um Nationalismus. Dass dies ebenso ein wichtiger Zugang gewesen wäre, zeigt sich spätestens, nachdem österreichische Fans in Leipzig mal wieder „Ausländer raus“ grölten und der türkische Spieler Merih Demiral das Handzeichen der rechtsextremen Gruppe „Graue Wölfe“ zeigte.
Obwohl sich keines der Kunstwerke dem Fußball mit Naivität nähert, spürt man in allen Inszenierungen eine unbändige Faszination für den Sport. Ob er als Choreografie verstanden wird, als Linse für Manifestationen von Männlichkeit, oder als das, was ein diffuses „uns“ zusammenhält. Darin nicht pathetisch zu werden, ist womöglich die eigentliche Kunst. Doch es gelingt den Künstler*innen – frei nach Lukas Podolski – zur EM nicht nur die Ärmel, sondern auch die Köpfe hochzukrempeln.