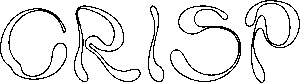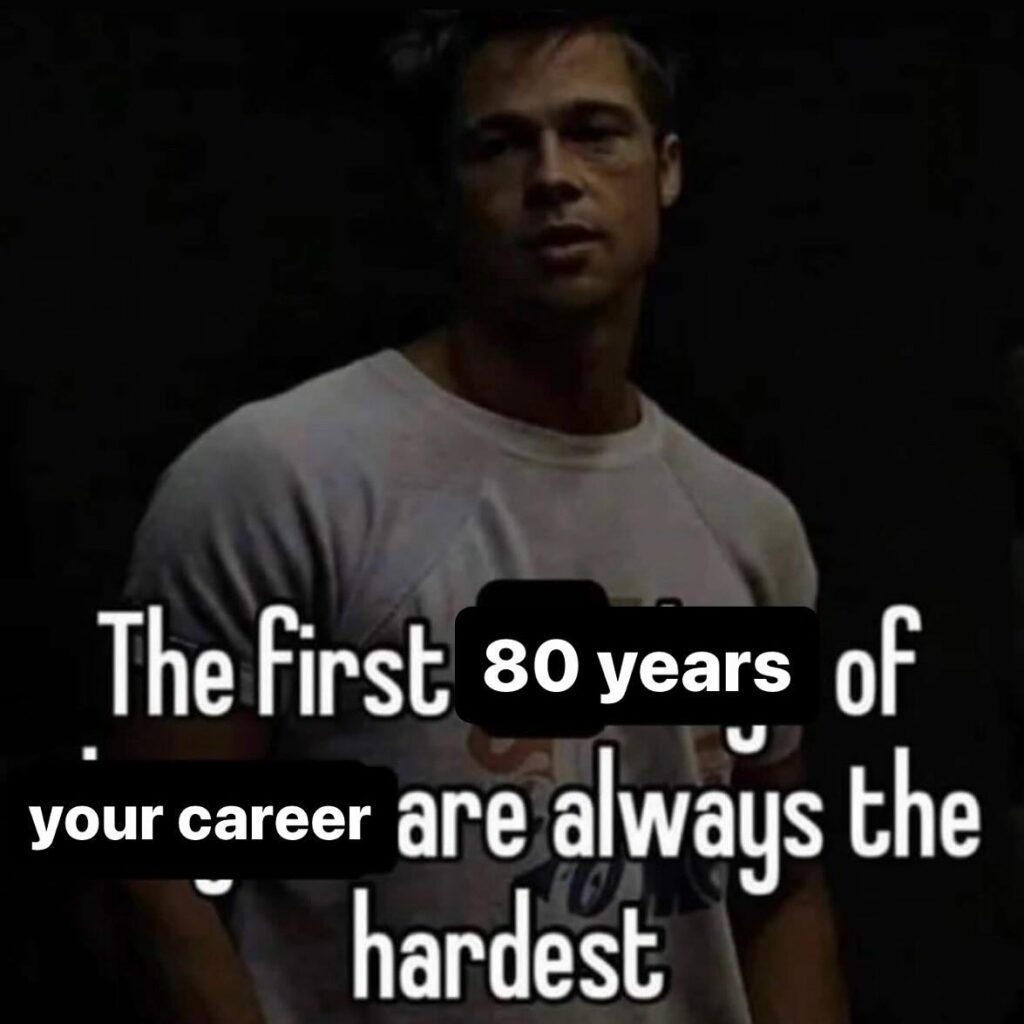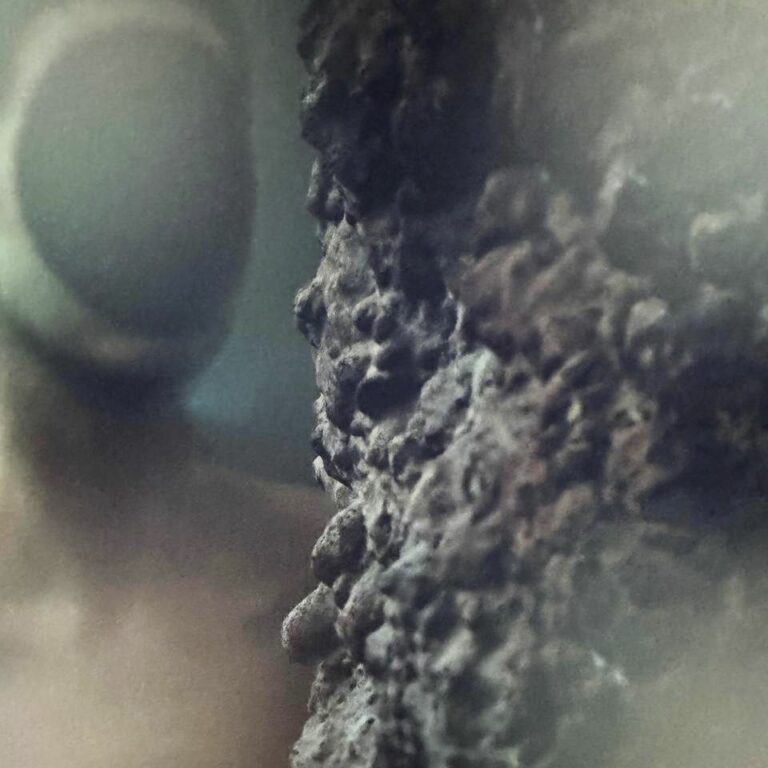Kunstproduktion ist hart, wenn man nicht reich ist. Der Brotjob für den Großteil der Kunstschaffenden: Fördergeldern, Galerist*innen und Sammler*innen hinterherrennen, mit Lohnarbeit die Miete stemmen und nebenbei noch Zeit für die Kunstproduktion finden. Ein Schritt vor und fünf zurück.
Wenn man sich dann nach der siebten Residenz-Absage wieder auf dem ungemütlichen Atelierhocker befindet, den man eigentlich schon letzten Sommer auswechseln wollte, erschlagen von der nächsten Niederlage, braucht man vor allem eines: Trost, ein fröhliches Manifestationsmantra oder einen guten Freund wie Brad Pitt, der einem Zuspruch ins Ohr flüstert: „Die ersten 80 Jahre deiner Karriere sind immer die schwersten.“
In einem zarten Anflug der Selbstumarmung visioniert man dann die Vorstellung der eigenen Kunstkarriere. Wo man eigentlich hinwollte, welche Kunstschaffenden-Karrieren einem dafür Vorbild waren. So schaut man auf die post-mortem Weltstars der bildenden Kunst wie Vincent van Gogh, Frida Kahlo und Jackson Pollock, die erst nach dem Tod durch die Decke gingen. Oder man schaut auf die vielen lokalen Biografien, die sich ihr Leben lang hochgearbeitet haben, sich ihre Position erkämpft, sie verteidigt und gehalten haben. Wenn man hart genug arbeitet, führt das irgendwann zum Erfolg. Das sagt man doch so im Spätkapitalismus. Der Mythos vom späten Erfolg gibt einem Halt.
Vielleicht ist in einer Wachstumsgesellschaft das Äquivalent zur Rente in der Kunst die späte Anerkennung innerhalb der Selbstdarstellungsära. So trösten wir uns weiter, indem wir auf ein Später hinarbeiten, das sicher in einer ungefähren Ferne liegt.